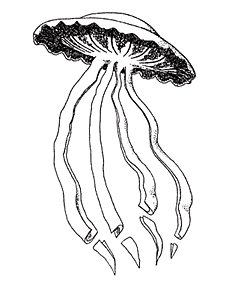- Get link
- X
- Other Apps
Stygiomedusa gigantea, allgemein bekannt als Riesenphantomqualle, ist ein Teil der monotypischen Gattung der Tiefseequallen, Stygiomedusa. Es gehört zur Familie der Ulmaridae. Mit nur rund 110 Sichtungen in 110 Jahren ist es eine Qualle, die selten zu sehen ist, aber mit Ausnahme des Arktischen Ozeans auf der ganzen Welt verbreitet sein soll. Die ferngesteuerten Unterwasserfahrzeuge des Monterey Bay Aquarium Research Institute haben die Qualle in 27 Jahren nur 27 Mal gesichtet. Eine vom Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom durchgeführte Studie, die sich auf vier im Golf von Mexiko vorkommende Stygiomedusa gigantea konzentrierte, enthüllte Informationen über die weitere Verbreitung dieser Art. S. gigantea gilt als einer der größten wirbellosen Raubtiere im Ökosystem. Es wird häufig in der Mitternachtszone des Ozeans gefunden und erreicht Tiefen von bis zu 6.665 m (21.867 ft). Aussehen S. gigantea hat eine schirmförmige Glocke, die bis zu 1 m (3,3 ft) groß werden kann. Das biegsame Gewebe der Glocke ermöglicht es der Qualle, sich um das 4- bis 5-fache ihrer Größe zu dehnen, vermutlich um ihre Beute zu verschlingen. Ihre vier Arme haben eine "paddelartige" oder "drachenartige" Form und können bis zu 10 m lang werden. Die Arme wachsen in einer "V"-Form quer, mit einer breiteren Basis und verjüngen sich zu den Enden hin. Sie haben keine stechenden Tentakel und verwenden stattdessen ihre Arme, um ihre Beute, die aus Plankton und kleinen Fischen besteht, zu fangen und zu verschlingen. Aus Brownes Analyse einer gesammelten S. gigantea geht hervor, dass ihr Gelee nur dann eine rot-orange Farbe hat, wenn sichtbares Licht vorhanden ist. Da sie jedoch in der Tiefsee leben, dringt sichtbares Licht nicht weit genug ein. So kann die Riesenqualle je nach Wassertiefe „unsichtbar“ erscheinen oder in ihrer Umgebung ganz schwach orange leuchten. Darüber hinaus ermöglichen ihre Körper, die entweder aus schwammigem Gewebe oder Gelee bestehen, der Art, dem enormen Tiefseedruck von 40.000 kPa (5.800 Pfund pro Quadratzoll) standzuhalten. Der kreisförmige Magen enthielt Kanäle, die zur Oberfläche des Unterschirms führten. Es wird gefolgert, dass der untere Bauch dick ist, um sicherzustellen, dass die Art die Kraft hat, ihre langen Arme zu tragen. Seine vier Geschlechtsöffnungen waren ebenfalls klein, um den Magen nicht zu schwächen. Da es weder Magentaschen noch radiale Kanäle gab, wurde die Qualle als Teil der Familie der Ulmaridae bestimmt. Verhalten Bekannt als eines der größten wirbellosen Raubtiere in der Tiefsee, besteht die typische Beute der Riesenphantomqualle aus Plankton und kleinen Fischen. Die S. gigantea dominiert in der Regel an Standorten mit einem System mit geringer Produktivität, was wiederum andere räuberische Organismen wie Fische von Systemen mit hoher Produktivität abhält (Küsten-, Auftriebszonen). Die Qualle bleibt jedoch ein wichtiges Raubtier für die Tiefsee und konkurriert oft mit Tintenfischen und Walen. Größere S. gigantea wurden auch in unmittelbarer Nähe von hydrothermalen Quellen beobachtet, wo große Anteile von Zooplankton reichlich vorhanden sind. Dies ist in mesopelagischen und bathypelagischen Tiefen. Je weiter entfernt von hydrothermalen Quellen, desto kleiner sind die Medusen – was darauf hindeutet, dass Zooplankton eine wichtige Ressource für die Art ist. Aus diesem Grund geht es den Medusen vom frühen Frühling bis zum frühen Sommer gut, wenn die Zooplanktonbiomasse erhöht wird. Es wurden Beweise gesammelt, um die allererste dokumentierte symbiotische Beziehung für einen ophidiiformen Fisch, Thalassobathia pelagica, zu unterstützen. Wissenschaftler haben beobachtet, dass die große, schirmförmige Glocke von S. gigantea Nahrung und Unterschlupf für T. pelagica bietet, während der Fisch der riesigen Phantomqualle hilft, indem er Parasiten entfernt. Das Gelee von S. gigantea, das T. pelagica Schutz bietet, ist angesichts des Mangels an Schutzressourcen in solch extremen Meerestiefen für die Fische unerlässlich. Studien zur weiteren Unterstützung dieser symbiotischen Beziehung haben gezeigt, dass sich die beiden Arten auch dann wieder miteinander verbinden, wenn sie getrennt sind. Es wurde gefolgert, dass T. pelagica aufgrund von Neuromasten, die die Empfindlichkeit für niederfrequente Wasserbewegungen erhöhen, die die Glocke der Qualle ausstrahlt, in der Lage ist, ihren Weg zurück zur riesigen Phantomqualle zu finden. Entdeckung Das erste S. gigantea-Exemplar mit einem Gewicht von 90 Pfund wurde 1899 gesammelt, aber erst 1959 als Art anerkannt. Obwohl innerhalb von 110 Jahren (1899–2009) nur 118 Individuen entdeckt wurden, hat die Meduse gelatinösen Schleim wurden gefunden, die Öffnungen bedecken, was darauf hinweist, dass sie in Schwärmen reisen können. Ähnlich große Gelee-Schyphomedusae wurden in Schwärmen vor der Westküste Nordamerikas beobachtet. Es gibt jedoch Fälle, in denen die Art allein gesichtet wird, wie z. B. die S. gigantea, die in einer Tiefe von 1.200 m (3.900 ft) im San Clemente Basin vor Kalifornien identifiziert wurde. Die riesige Phantomqualle kommt auf der ganzen Welt mit Ausnahme des Arktischen Ozeans vor. Sie befinden sich typischerweise bei 61°N–75°S und 135°W–153°O. In Gebieten mit hohen Breitengraden im südlichen Ozean liegt die Tiefe, in der die Art gefunden werden kann, auf mesopelagischer und epipelagischer Ebene. In Gebieten mittlerer bis niedriger Breiten kommen die Arten jedoch typischerweise auf bathypelagischen und mesopelagischen Ebenen vor. Dies liegt an der Variabilität der Temperatur und der Lichtverteilung des Ozeans. Reproduktion Die Bestimmung der Reproduktion der S. gigantea ist schwierig, wenn man bedenkt, wie selten Sichtungen sind. Es wurde festgestellt, dass junge gefangene S. gigantea wie eine exakte Miniatur des Erwachsenen aussahen. Forscher haben jedoch die Struktur und Anatomie der Qualle ausreichend analysiert, um zu verstehen, wie sie sich reproduzieren kann. Die S. gigantea hat vier Brutkammern, die in gefalteten schmalen Graten und Epithel, das die Magenseite bedeckt, in den Magen hineinragen. Seine untere Peripherie hat Rüschen entlang der Falten, wodurch ein etwa 20 Millimeter (0,79 Zoll) hohes Band entsteht. Oberhalb dieses Bandes befindet sich eine Keimlinie, die eine flache Rinne mit verschiedenen Epithelzellen bildet, die eine eher kubische Form mit großen, abgerundeten Kernen haben. Eine unregelmäßige Platzierung der Zellen in kleinen Gruben (kleine Zellklumpen, ähnlich einer Zyste) entlang der Keimbahn führt zu einer Vermehrung von Epithelzellen, die eine tiefe Einstülpung erzeugen. Dies ist die erste Stufe, die zur Vermehrung von S. gigantea führt. Die Zyste wächst mit einem spitzen Ende auf der Unterschirmseite. Mit zunehmender Größe drückt es die Brutkammerwand heraus und in den Hohlraum der Kammer. Gleichzeitig entwickeln sich am gegenüberliegenden Ende zwei horizontale Auswüchse, die die Zyste zu einer "T" -Form machen. Dieser ragt mit zunehmender Größe immer weiter heraus und nimmt den Brutraum mit. Schließlich bildet sich eine dünne Membran und die Zyste dringt in die Magenhöhle ein. Innerhalb der Zyste bildet sich ein Scyphistoma – eine einzelne sich entwickelnde Medusa – und wird jetzt als Chorion bezeichnet. Sobald das Chorion zu einer Länge von etwa 2 mm (79 mil) und einem Durchmesser von 2–3 mm (79–118 mil) mit zitzenförmigen distalen Enden (die basale Auswüchse sind) heranwächst, beginnt es, aus der Kammer herausgedrückt zu werden. Innerhalb der Chorionkapsel beginnt die Differenzierung und Bildung. Die innere Epithelwand stammt direkt aus dem Ausgangsgewebe und ist in ihre distalen Spitzen eingesteckt, die schließlich zu den Armen von S. gigantea werden. Wenn die „Baby“-Medusa wächst, nimmt sie die Form der Kapsel an. Um zu entkommen, löst sich die gut entwickelte "Baby"-Medusa von der Unterschirmwand, wo sie bereits leicht hervorstand. Es tritt dann durch die Magenhöhle und den Mund der Eltern aus. Die Baby-Medusen werden bald zu frei schwimmenden Planules, dann zu Polypen oder Scyphistomae, die sich ungeschlechtlich durch Knospung oder Podocysten vermehren. Diese werden zu Medusenlarven, die sich von Plankton ernähren. Irgendwann wächst es auf die Größe eines Erwachsenen heran. Es wird gefolgert, dass die Reproduktion von S. gigantea kontinuierlich ist, wobei ein Elternteil geschätzt wird, dass er fünfzig bis hundert Medusen produziert.
- Get link
- X
- Other Apps